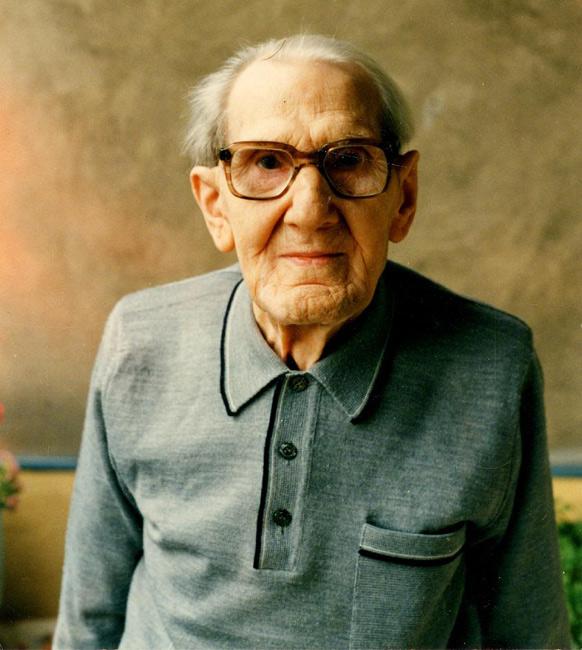Susanne Beer
Warum halfen einige Menschen jüdischen Verfolgten, während ihre Nachbarn und Bekannten wegschauten oder sich gar an der Gewalt beteiligten? Warum riskierten sie ihren Ruf, ihre Freiheit und ihr Leben für Personen, die sie häufig nicht einmal kannten? Die sogenannten ‚Judenretter‘ werfen Fragen über die ‚Natur des Guten‘ auf und darüber, wie solidarisches Verhalten in Situationen kollektiver Gewalt entsteht. Überraschenderweise haben bislang nur wenige Forscher versucht, diese Fragen durch empirische Untersuchungen zu beantworten. Das Projekt „Referenzrahmen des Helfens“ soll diese Forschungslücke schließen und aus sozialpsychologischer Sicht erklären, wie aus Zuschauern Helfer wurden.
Der Begriff des ‚Referenzrahmens‘ geht auf den amerikanischen Soziologen Eving Goffman zurück, der darunter Deutungsschemata zusammenfasste, mit denen Akteure die Welt interpretieren und diese versuchen, sinnvoll auszulegen. Solche Deutungsschemata, die für die Entscheidung zum Helfen ausschlaggebend waren, werden im Kontext des Projekts rekonstruiert, um ihren sozialen Kontext zu verstehen. Nicht Persönlichkeitsstrukturen und Charaktereigenschaften der Helfer stehen also im Vordergrund, sondern die sozialen Konstellationen, die zur Entstehung des Hilfeverhaltens führten. Ein Vorteil dieses situativ ausgerichteten Ansatzes besteht darin, dass auch solche Personen in das Blickfeld geraten, die widersprüchlich agierten und sich nicht durchweg als ‚stille Helden‘ beschreiben lassen. Bezahlte Helfer und solche mit antisemitischen Einstellungen werden ebenso aufmerksam untersucht, wie Personen die dem Idealbild eines antifaschistisch eingestellten Retters entsprechen.
Eine unabdingbare Voraussetzung für entsprechende Situationsanalysen sind Quellen, die eine dichte Rekonstruktion der Entscheidungsprozesse ermöglichen. Das Projekt „Referenzrahmen des Helfens“ kann hierfür auf einen europaweit einmaligen Quellenbestand zurückgreifen, der seit den 1980er Jahren von Berliner Historikerinnen und Historikern aufgebaut wurde und derzeit an der Gedenkstätte Deutscher Widertand archiviert wird. Aus diesem Bestand wurden über 100 Interviews mit ehemaligen Helfern und Verfolgten ausgewählt, transkribiert und mithilfe einer Software kodiert. Die Auswertung des Materials erfolgt in drei Teilstudien: Die erste beschäftigt sich mit ‚Helferkarrieren‘ und analysiert die sozialen Kontexte der Genese und Verstetigung des Hilfeverhaltens. Die zweite untersucht mit Hilfe der historischen Netzwerkanalyse, wie weitverzweigte Hilfenetzwerke entstanden. Die dritte Teilstudie schlägt schließlich eine Brücke zur neuen Täterforschung, um zu allgemeinen Erkenntnissen über individuelles Handeln in Kontexten kollektiver Gewalt zu gelangen.
Welche Ergebnisse lassen sich aus den bisherigen Auswertungen ableiten? In Übereinstimmung mit früheren Untersuchungen zeigt sich, dass das Rettungshandeln mehrheitlich nicht von den Helfern selbst ausging, sondern durch die jeweils Verfolgten oder von deren Bekannten initiiert wurde. Offenbar war es für viele Zuschauer wichtig, mit einem konkreten Einzelschicksal konfrontiert zu werden. Das Wissen um persönliche Handlungsmöglichkeiten wurde dabei gewissermaßen von außen – durch persönliche Anfragen – an die Helfer herangetragen. Interessant ist ebenfalls, dass durch Hilfebitten Personen zur Mithilfe gewonnen werden konnten, die ihrerseits keine Neigung zum Helfen verspürten. Die Berliner Helferin Auguste Leißner gab beispielsweise an, die antisemitischen Verfolgungen überhaupt nicht bewusst wahrgenommen zu haben. Sie habe sich mehr für ihre Arbeit als für politische Angelegenheiten interessiert. Als ihr Vorgesetzter sie dann um das Versteck eines jüdischen Mädchens bat, lehnte sie zunächst ab, da sie nicht in riskante Aktivitäten involviert werden wollte. Der Vorgesetzte scheint daraufhin Druck ausgeübt zu haben, so dass Leißner schließlich doch zustimmte: „Jeder ist mal von einem anderen abhängig gewesen“, erklärte sie später ihre Entscheidung.
Auffällig ist auch, dass der Zusammenhang zwischen politischem Widerstand und Hilfeverhalten eher schwach ausgeprägt war. Nur ein geringer Teil der deutschen Helfer war vor 1933 in einer politischen Partei organisiert und nur ein kleiner Teil leistete Widerstand gegen andere Aspekte der nationalsozialistischen Politik. Allerdings muss dieser Befund für unterschiedliche Helfertypen differenziert werden. Personen, die im Zentrum von Hilfenetzwerken standen, bewegten sich oftmals bereits seit Mitte der 1930er Jahre in resistenten Milieus und fanden hier auch Kontakt zu potentiellen Mithelfern.
Für unorganisierte Einzelhelfer haben solche Milieus dagegen eine untergeordnete Rolle gespielt. Wichtiger scheinen hier langjährige persönliche Kontakte zu Juden gewesen zu sein. Obwohl die jüdische Bevölkerung seit Ende der 1930er Jahre weitgehend isoliert war, bestanden durch Freundschaften und Verwandtschaftsbeziehungen noch bis in die 1940er Jahre hinein Kontaktzonen zwischen jüdischer und nicht-jüdischer Bevölkerung. Paradoxerweise führten auch manche antisemitische Maßnahmen dazu, dass bestimmte Berufsgruppen in täglichen Kontakt mit den Verfolgten kamen. Dies war beispielsweise bei Irene Block der Fall, einer Frankfurter Rechtsanwältin, die sich auf Devisenrecht spezialisiert hatte und bis zu 200 Juden in Steuer- und Emigrationsfragen beriet. Im September 1942 versteckte sie ihre Klientin Maria Fulda, als diese von der unmittelbaren Deportation bedroht war. Auch der Berliner Otto Jogmin wurde auf Grund seiner beruflichen Stellung zum Helfer. Er war seit 1935 Hauswart eines Gebäudes mit zahlreichen jüdischen Mietern. Seine Hilfe entwickelte sich zunächst im Rahmen seiner Tätigkeit als Hausmeister, etwa indem er Schäden in den Wohnungen reparierte und half, die Türen gegen unliebsame Eindringlinge zu sichern. Später versteckte er mindestens acht jüdische Verfolgte in leerstehenden Wohnungen und in einem extra dafür hergerichteten Keller des Hauses.
Wer sich einmal zum Helfen entschlossen hatte, war mit den Verfolgten durch das gemeinsame Geheimnis des Gesetzesbruches verbunden. Wurden die Verfolgten entdeckt und verhaftet, mussten auch die Helfer befürchten, dass ihre Namen genannt und sie selbst in die Fänge der Gestapo geraten würden. Man kann daher von einer inneren Logik des Helfens sprechen, die es erschwerte sich nach einmal begonnener Hilfeleistung wieder zurückzuziehen. Hinzukommen emotionale Bindungen, die sich durch das enge Zusammenleben, die Sensibilisierung für das Leiden der Verfolgten und das gemeinsame Hoffen auf ein baldiges Kriegsende ergaben. Selbst Personen, die nur gelegentlich Hilfe leisteten, fühlten sich verpflichtet, die Erwartungen der Verfolgten nicht zu enttäuschen. Der an der Schweizer Grenze lebende Josef Höfler berichtete etwa, dass er zunächst nur eine ihm vermittelte Berliner Jüdin über die Grenze bringen wollte. Doch seine Hilfebereitschaft sprach sich herum und so wurde Höfler immer wieder gebeten, weiteren Personen den Grenzweg zu zeigen. In einem Interview erinnerte er sich später: „Ich habe jedes Mal schon Bedenken gehabt und hab jedes Mal gesagt: ‚Jetzt ist aber Schluss, jetzt mach ich nichts mehr.‘ […] Und immer sind sie wieder (gekommen): ‚Helfen Sie uns doch bitte. Tun Sie uns doch das Leben retten. Seien Sie doch so gut und helfen Sie uns‘. Sie haben so lang gebittet, bis ich gesagt hab: ‚Ja klar, ja dann machen wir’s halt noch mal.“
Einiges spricht dafür, dass für die Entwicklung vom Zuschauer zum Helfer gute Vorsätze keine ausschlaggebende Rolle spielten. In den meisten Fällen folgten die Helfer jedenfalls keinem innerlich gereiften Plan, sondern reagierten spontan auf eine an sie heran getragene Hilfebitte. Das Gefühl, diese Bitte nicht abschlagen zu können, führte in manchen Fällen sogar dazu, dass Personen gegen ihre ursprünglichen Vorsätze zu Helfern wurden. Inwieweit diese Beobachtungen verallgemeinert werden können, werden die weiteren Auswertungen zeigen. Genauere Informationen über Veranstaltungen und Publikationen des Projektes „Referenzrahmen des Helfens“ können unter folgender Webseite abgerufen werden
Susanne Beer ist seit 2008 Junior Fellow am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen und Mitarbeiterin des Forschungsprojekts „Referenzrahmen des Helfens“. Davor hat sie für verschiedene Träger der historischen und politischen Bildung gearbeitet, u.a. für die Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück.